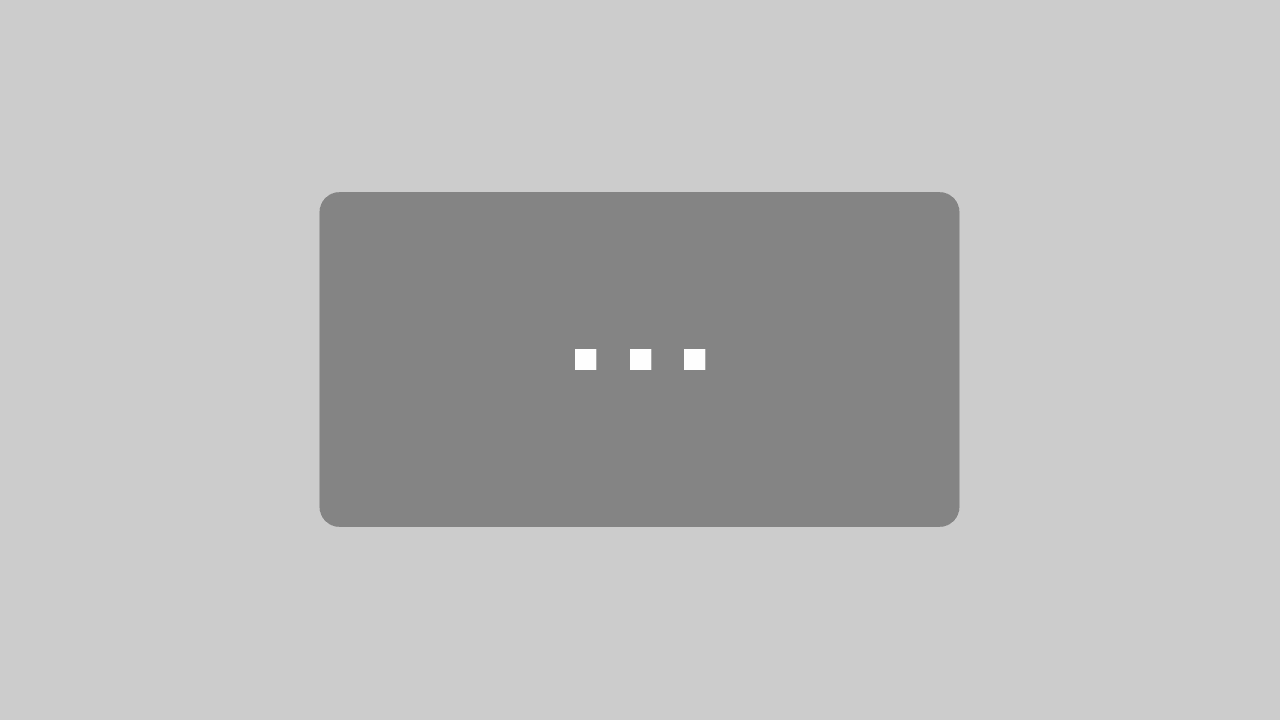Mit der Speedfactory will Adidas den Schuhmarkt revolutionieren und in kürzester Zeit individuelle Traumschuhe produzieren. Neu ist dieses System aber nicht. Denn den Maßschuh gibt es schon seit Jahrhunderten beim Schuhmacher. Bis der fertige Schuh den Fuß schmückt, ist es jedoch ein langer Weg. // Von Anne Schiebener und Rebekka Vitz
15.07.2016//Der Schuh etabliert sich mehr und mehr als neues Statussymbol. Nike, Adidas, Converse, Vans - die Liste der beliebten Marken ist lang. Um sich von der Masse abzuheben, müssen die Hersteller immer wieder neue Ideen entwickeln. Nike setzt dazu seit längerem auf die Personalisierung und bietet dem Kunden die Möglichkeit, das Design der neuen Schuhe komplett selbst zu bestimmen. Nur das Modell an sich gibt Nike noch vor. Auch Adidas setzt auf den Trend der Personalisierung und will diesen jetzt in einem Pilotprojekt revolutionieren. Im Dezember 2015 stellte das deutsche Unternehmen seine neue Fertigungsanlage, die Speedfactory, in Ansbach vor. Die Vision ist es, neben dem Design, in Zukunft auch die Form der Schuhe komplett nach Kundenwünschen zu gestalten. Dabei kommt modernste Robotertechnologie zum Einsatz, welche die bisherige Handarbeit zum Großteil ersetzen und eine flexiblere Herstellung ermöglichen soll. Die ersten 500 Paar Laufschuhe aus der Speedfactory waren für die erste Jahreshälfte 2016 angekündigt. Laut Adidas verschiebe sich der Termin nun in die zweite Jahreshälfte, konkrete Angaben wolle man aber noch nicht machen. 2017 soll die Serienproduktion der personalisierten Schuhe starten. Durch die hohe Automatisierung in der Anlage, werden diese eine wesentlich kürzere Lieferzeit haben als bisher. Momentan wartet der Kunde bis zu acht Wochen auf sein ganz individuelles Schuherlebnis. Das Repertoire von Adidas und Co ist allerdings begrenzt. Was machen Kunden, die keinen Sportschuh, sondern einen schicken Herren Slipper oder klassischen Schnürschuh haben möchten? Wer ein gutes und maßgeschneidertes Paar Schuhe brauchte, hat vor 100 Jahren nicht den Onlineshop, sondern den Schuhmacher seines Vertrauens besucht. Auch heute gibt es noch über 5.000 Schuhmacher in Deutschland, die einem beinahe jeden Wunsch passgenau erfüllen können.
Meister Stallmann und seine Schuhe
Ein Geruch von frisch gegerbtem Leder und Schuhcreme verbreitet sich im Laden. Im hinteren Teil, der Werkstatt, riecht es stark nach Klebstoff. Da fehlt noch die Dunstabzugshaube, die die Dämpfe einsaugt. Philipp Stallmann nimmt den Klebergeruch schon gar nicht mehr wahr. Trotzdem sind es die Sinne, die ihn jeden Tag aufs Neue an seiner Arbeit faszinieren. Philipp Stallmann ist Schuhmacher. Im vergangenen Sommer eröffnete er seine eigene Werkstatt in Köln-Ehrenfeld. Neben dem speziellen Schuhmacherei-Geruch, der zu seinem Beruf gehört, gibt es bei Meister Stallmann auch vieles zu hören, tasten und sehen. "Ich arbeite jeden Tag mit Holz und Leder. Das sind Materialien, die eine interessante Haptik haben und sich immer anders anfühlen", sagt Stallmann. Die Werkstatt befindet sich im hinteren Teil des Ladens, abgetrennt durch Fensterscheiben. Im Schaufenster stehen natürlich Schuhe, dahinter zwei bequeme Sessel. Hohe Decken, ein altes Radio, Kassentresen aus den 60ern - all das harmoniert mit den alten Werkzeugen, die Stallmann tagtäglich für seine Arbeit braucht. "Ich muss auch darauf achten, wie unterschiedlich sich die Materialien anhören", sagt er. "Ich muss hören, ob ich zum Beispiel den Schuh bis auf das Metall geschliffen habe." Nur zu schmecken gibt es nichts. "Manchmal aus Versehen", scherzt er.
So wird ein Schuh draus
Vom ersten Besuch des Kunden bis zum fertigen Maßschuh vergehen schnell drei Monate. Zu Beginn müssen die Füße des Kunden vermessen werden. Dafür wird ein Tintenabdruck des Fußes gemacht und vier Umfangmaße genommen. "Danach habe ich die Silhouette des Fußes und eine Vorstellung davon, wie er aussieht." Im nächsten Schritt wird der Leisten gebaut. Das gehört zu den schwierigsten Arbeitsschritten. Im Wesentlichen gibt es drei Teile beim Schuhbauen, nämlich den Leisten-, Schaft- und Bodenbau. Der Leisten ist ein Holzfuß, der den Fuß des Kunden nachbildet. "Der muss perfekt sein, denn da steckt das Maß drin", sagt Stallmann. Es hat sich in der Schuhproduktion nicht viel geändert. Nur den Leisten baut er nicht mehr so wie es früher üblich war, obwohl er es noch traditionell gelernt hat. Damals hatte man ein Lager voller Holzstücke, um daraus Leisten nachzubauen. "Dann kostet der Schuh aber nicht 900, sondern 1.900 Euro, weil ich zwei Tage lang im Buchenholzstaub an der Maschine stehen würde." Heute bestellt Stallmann Leistenrohlinge in passender Größe und mit richtigem Ballenumfang. Hat der Kunde einen besonders schmalen Rückfuß oder einen ganz flachen Spann, kann der Schuhmacher das durch Wegschleifen oder Drankleben am Buchenholzrohling korrigieren. Ist der Holzfuß fertig, gibt es eine erste Anprobe über einen Probeschuh. Das ist einfach ein Klarsichtschuh in der Form des Leisten. Stallmann malt dann mit einem schwarzen Stift auf, wo der Schuh noch drückt. "In diesem Fall war der Fersen noch ein bisschen zu breit, es hat am kleinen Zeh gedrückt, hier war zu viel Luft und der Schuh einen halben Zentimeter zu kurz", zeigt er anhand von schwarzen Strichen und Wellen am Plastikschuh. Also nochmal ran an den Leisten für den letzten Feinschliff.

Der Probeschuh zeigt, wo noch nachgebessert werden muss. // Foto: Anne Schiebener
Der Maßschuh bekommt sein Oberteil
Im nächsten Schritt startet die Produktion des Schaftes. Der Schaft ist das Oberteil des Schuhs. Zuerst muss ein Schnittmuster erstellt werden. Dafür legt Stallmann eine Folie auf den Leisten und zeichnet diesen ab. "Ich muss den dreidimensionalen Leisten in eine zweidimensionale Form bringen", erklärt er. Davon wird dann das Grundmodell abgeleitet, woraus sich das Schnittmuster des kompletten Schuhs ergibt. "Für komplizierte Schuhe gehe ich zum Schäftemacher." Das ist nochmal ein eigenständiger Beruf. Ist das Oberleder, also der Schaft, fertig, wird dieser um den Leisten modelliert, um daran die Sohle zu befestigen. Der Schuhmacher nennt das auch zwicken. "Der Bodenbau ist mein Lieblingsarbeitsschritt", sagt Stallmann. "Das Oberleder ist flach, aber ich fertige daraus ein richtiges Objekt." Der halbfertige Schuh braucht jetzt nur noch eine Sohle. In den hinteren Teil des Schuhs wird ein Metallgelenk eingebaut. Gelenk ist eigentlich das falsche Wort, denn es bewirkt das Gegenteil: es versteift den Schuh hinten, damit zwischen Absatz und dem vorderen Auftritt sich der Schuh nicht durchdrückt. Auf das Gelenk kommt ein Lederstück, das Gelenkstück. Vorher wird der Leisten aber noch einmal herausgenommen für eine Anprobe des Kunden. "Danach kann ich noch Feinjustierungen an den Schnürungen oder am Spann vornehmen. Dann baue ich den Boden, also die Sohle, der Kunde kann die Schuhe abholen, ein letztes Mal anprobieren und mitnehmen."
Kunde ist König
Jungen Leuten rät Stallmann die Ausbildung zum Orthopädieschuhmacher, denn dort werden mehr Schuhe gemacht als bei einem einfachen Schuhmacher. Aussterben wird aber auch dieser Beruf nicht. Stallmann glaubt, dass er sogar im Kommen ist, da das Qualitätsbewusstsein der Menschen für gute Schuhe wieder steigt. Auch Peter Schulz vom Zentralverband des Deutschen Schuhmacher-Handwerks sagt: "In Deutschland gibt es 80 Millionen Menschen, das heißt also auch, dass es 160 Millionen Füße gibt, die Schuhe brauchen."
In einem Monat fertigt Stallmann ungefähr fünf Paar Maßschuhe. Seine Kunden sind häufig Männer zwischen 55 und 75 Jahren aus gutverdienenden Berufen, Kinder aus dem Haus, Luxuswagen vor der Tür. "Das habe ich mir am Anfang anders gedacht. Ich dachte, es kommen die jungen hippen Ehrenfelder, 35 bis 45 Jahre", sagt Stallmann. "Aber klar, die jungen Leute haben keine Kohle. Die gründen Familien und bauen Häuser. Die brauchen keine Maßschuhe." Für Stallmann sind gute Schuhe aber keine Frage des Geldes, sondern der Priorität. "Ich habe auch schon einmal Maßschuhe für einen Studenten gemacht", erzählt er. "Der war zwei Jahre nicht im Urlaub und hat das Geld dann dafür zusammengespart."

Durch das Aufrauen der Sohle haftet der Klebstoff später besser. // Foto: Anne Schiebener
Gefährliche Massenproduktion
Trotzdem kann oder will sich nicht jeder das maßgeschneiderte Produkt vom Schuhmacher leisten. Die im Geschäft gekaufte Massenware stammt meistens aus Produktionen in Asien oder Osteuropa. Laut dem Südwind Institut für Ökonomie und Ökomene wurden 2014 allein in China über 15,7 Milliarden Paar Schuhe hergestellt. Dies entspricht einem Marktanteil von fast 65 Prozent. Die Produktion läuft oftmals unter menschenunwürdigen und gesundheitsgefährdenden Bedingungen ab. Beispielsweise wird das Leder für die Schuhe überwiegend unter Einsatz verschiedener chemischer Elemente wie Chrom III gegerbt, also vom bloßen Tierfell in Leder umgewandelt. In Asien wird dabei oft noch veraltete Technik zum Gerben eingesetzt, sodass sich das unbedenkliche Chrom III oftmals in giftiges Chrom VI umwandelt. Dieses ist sowohl für den Menschen als auch für die Umwelt extrem schädlich. Bei längerem oder häufigem Hautkontakt kann es neben allergischen Reaktionen auch Krebs auslösen. Verätzungen der Atemwege oder Augen sind bei den Arbeitern ebenfalls keine Seltenheit. Selbst beim Endverbraucher in Deutschland kann es noch zu allergischen Reaktionen kommen, wenn der Chrom VI Anteil im fertigen Schuh zu hoch ist. Eine andere Möglichkeit wäre, das Leder mit pflanzlichen Stoffen zu behandeln. Dies ist jedoch zeitaufwendiger und teurer, sodass es sich bisher nicht als Alternative in der Industrie etablieren konnte.
Des Weiteren ist das Gehalt der Arbeiter so gering, dass sie davon kaum ihren Lebensunterhalt finanzieren können. "Die Leute müssen, um überhaupt auf einen halbwegs anständigen Lohn zu kommen, sehr viele Überstunden machen. Dabei ist nicht klar, in wie weit diese überhaupt freiwillig sind. Das nennen wir in so einem Fall schon Zwangsarbeit", sagt Anton Pieper vom Südwind Institut. Er beschäftigt sich intensiv mit den Arbeits- und Menschenrechten in der Schuh- und Lederproduktion und beteiligt sich mit dem Institut an der Initiative "Change your Shoes", die 2015 im Rahmen der "Kampagne für saubere Kleidung" entstand. Insgesamt 18 Organisationen für Menschen- und Arbeitsrecht setzen sich für bessere Arbeitsbedingungen in den Schuhfabriken und mehr Transparenz in Europa ein. "Das Thema wird in der Öffentlichkeit und in den Medien gut aufgenommen. Viele empören sich, dass es so lange im Schatten geblieben ist", sagt auch Berndt Hinzmann vom Inkota Netzwerk, das sich ebenfalls für eine gerechte Weltwirtschaft einsetzt und sich an der Initiative beteiligt. "Viele sagen, wir brauchen mehr Transparenz als Verbraucher." (Siehe Kontextbox)
Keine Angst vor der Speedfactory
Philipp Stallmann bekommt sein Leder von Lieferanten aus Italien und Bad Honnef. Bis er das passende Material für seinen Kunden bekommt, dauert es. Deswegen arbeitet er an mehreren Schuhen gleichzeitig. Die drei Monate, die ein Kunde meist auf seinen Schuh warten muss, stehen im Gegensatz zu den wenigen Tagen, die die Speedfactory von Adidas für einen personalisierten Schuh brauchen würde. Der Schuhmacher sieht darin jedoch keine Bedrohung für seinen Beruf. "Jemand, der Maßanzüge fertigt, hat auch keine Angst vor H&M," sagt er. "Man muss sich über die Speedfactory fast freuen, weil dann endlich mal wieder was in Deutschland hergestellt wird." Auch Peter Schulz von der Schuhmacherinnung fände es gut, wenn durch dieses Projekt die Schuhproduktion zurück nach Deutschland käme. "Eine wirkliche Konkurrenz für die deutschen Schuhmacher wird das aber wohl kaum werden, da die Speedfactory wenig mit dem klassischen Beruf des Schuhmachers zu tun hat", sagt Schulz.
Mit 34 Jahren hatte Stallmann beruflich und finanziell alles erreicht, was er erreichen konnte. Nach seiner Ausbildung hat er seinen Meister gemacht, verschiedene Arbeitsstellen angetreten und auch ein halbes Jahr nur im Büro gearbeitet. "Aber das war furchtbar langweilig, den ganzen Tag nur im Büro zu sitzen", sagt Stallmann. "Also wenn raus aus der Werkstatt nicht geht, dann geht nur noch richtig rein. Und richtig rein ist das hier." Er zeigt um sich, klopft sich auf die Beine. Seine eigene Schuhmacherei, die bald ein Jahr alt wird.
Audioslideshow über die Arbeit von Philipp Stallmann
Der Lehramtsstudent, der Schuhmacher wurde

Schuhmachermeister Philipp Stallmann // Foto: Anne Schiebener
Die tabakfarbenden Steilderbys aus Rauleder mit den blauen Schnürsenkeln fallen sofort ins Auge. Schick, dezent, passend. Sein Schuhgeschmack spiegelt Philipp Stallmanns Charakter wieder. Aufgeschlossen aber nicht aufdringlich, dabei stilvoll und sympathisch. Der kleine Verkaufsraum mit der anschließenden Werkstatt rundet das Bild ab. Stallmann ist ein bodenständiger Typ, der im Kölner Stadtteil Ehrenfeld seit einem knappen Jahr sein Glück als selbstständiger Schuhmacher sucht. „Ich wollte was ganz Grundständiges lernen. Automechaniker wäre nichts für mich gewesen“, begründet der 36-Jährige die Wahl seines Berufs. Eine Tante mit krummen Füßen und orthopädischen Schuhen spielte dann auch noch eine kleine Rolle. Zunächst ging Stallmann aber andere Wege. Nach seinem Abitur 1999 leistete der gebürtige Bonner erst seinen Zivildienst ab, bevor er 2000 ein Studium zum Grundschullehrer an der Uni Köln begann. Nach drei Semestern war damit aber Schluss – zu unstrukturiert, zu viel Diddl-Papier, lautete Stallmanns Fazit. Es musste doch etwas Handfesteres sein. Daraufhin begann er 2003 eine 3 ½ jährige Ausbildung zum Orthopädieschuhmacher, die er 2009 mit der Meisterprüfung vollendete. Ein paar Jobs folgten, lange hielt er es aber nie in einer Anstellung aus. Im August 2015 entschied er sich dann den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, sehr zum Leidwesen seiner Eltern. Beide waren Apotheker und nicht gerade begeistert von seiner Idee, auf eigenen Beinen zu stehen. Abbringen ließ sich Stallmann davon allerdings nicht. „Ich bin eigensinnig und etwas beratungsresistent“, sagt er. Da er gerne experimentiert, konnte er sich unter den strengen Vorgaben der alten Arbeitgeber nie ganz entfalten. Jetzt ist er sein eigener Chef und kann seine Kreativität ausleben.
Missstände in der Massenproduktion
Nicht nur in den Gerbereien sind die Arbeitsbedingungen mehr als fragwürdig. Den Großteil der Arbeit bei der eigentlichen Schuhproduktion verrichten Frauen, die in vielen Fabriken von den männlichen Vorarbeitern diskriminiert und unterdrückt werden. Es gibt, wenn überhaupt, nur unzureichende Schutzvorkehrungen, sodass die Mitarbeiterinnen giftigen Klebstoffen ausgesetzt sind und ihre Dämpfe ungefiltert einatmen. Des Weiteren existieren weder Sozial- noch Altersvorsorgen und durch die sehr gängige Praxis der Heimarbeit werden auch Kinder für die Herstellung mit eingespannt. Ein Ziel der Initiative „Change your Shoes“ ist daher die Konzipierung eines Siegels, das mehr Klarheit über die Herkunft der Schuhe und Materialien geben soll. „Ein Siegel, das nur anzeigt, ob mit Chrom gegerbt wurde oder nicht, reicht natürlich noch nicht. Wir haben auch Arbeitsrechtverletzungen bei Plastik- und Gummischuhen. Im Prinzip muss ein Siegel für einen hohen sozialen und ökologischen Standard drauf. Das wird allerdings noch eine Weile dauern“, sagt Anton Pieper und sieht dabei ganz klar die Politik in der Verantwortung. „Es muss eine EU weite Kennzeichnungspflicht geben.“ Verbraucher hingegen können eher wenig machen, da momentan noch die Alternativen auf dem Markt fehlen. Lediglich das eigene Konsumverhalten kann geändert werden. Pro Kopf verbrauchen die Deutschen im Jahr mehr als fünf Paar Schuhe. Das liegt unter anderem daran, dass sie zu einem Wegwerfgegenstand geworden sind. Wer früher seine Schuhe noch zur Reparatur gebracht hat, kauft heute lieber ein neues Paar. Die nur sehr kurzeitigen Modetrends tun dabei ihr Übriges und veranlassen die Kunden dazu, immer mehr Schuhe zu kaufen, die sie eigentlich nicht benötigen würden. Auch die Speedfactory könnte so ein Verhalten noch bestärken, meint Berndt Hinzmann. „Dementgegen steht nur der relativ hoch angesetzte Preis von 300 US-Dollar. Dieser ist allerdings auch immer Markengenerierung. Ein hoher Preis suggeriert einen Mehrwert“, sagt er. Auch Anton Pieper sieht das Projekt zwiegespalten, da der Einsatz von Maschinen einerseits die Anzahl der Menschenrechtsverletzungen reduzieren kann aber andererseits auch Arbeitsplätze wegnimmt. Eine wirklich spürbare Wirkung in Bezug auf die Produktion in Asien und Osteuropa trauen beide der Speedfactory aber nicht zu.
Die Autorinnen

Anne Schiebener

Rebekka Vitz