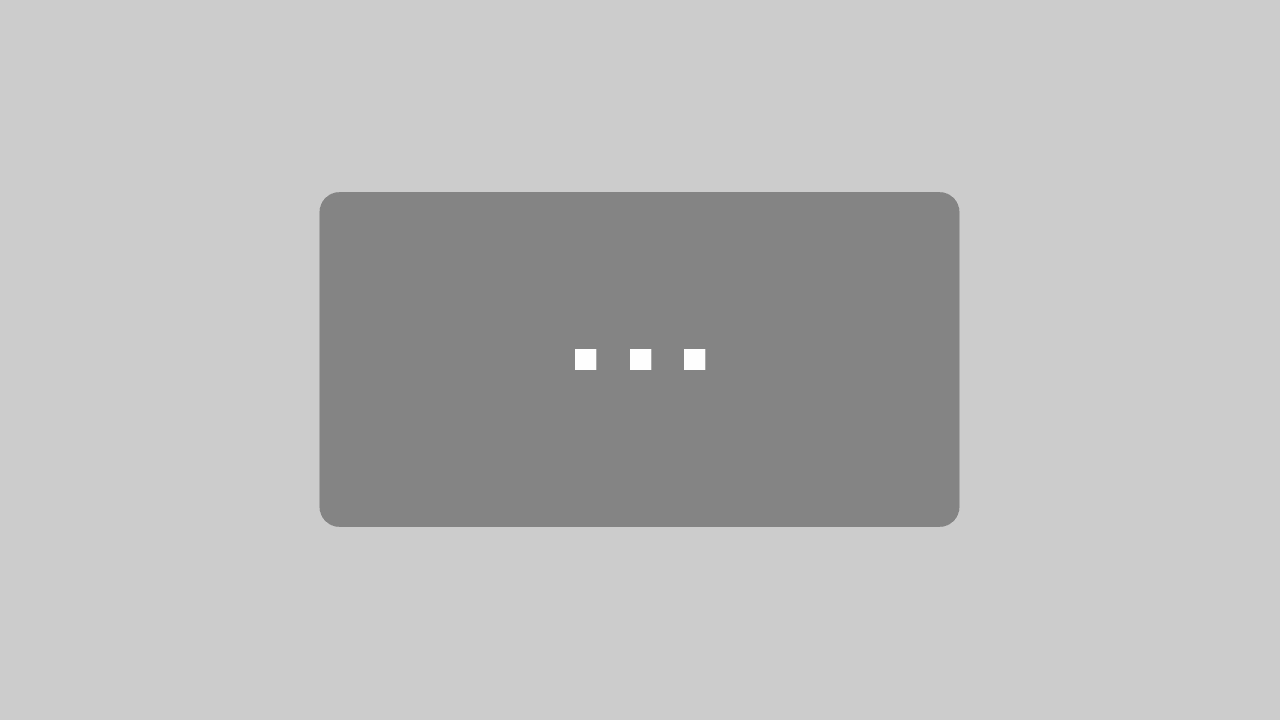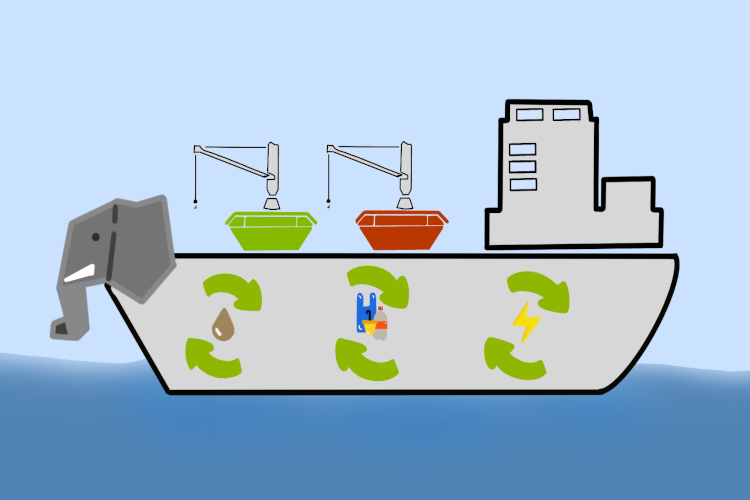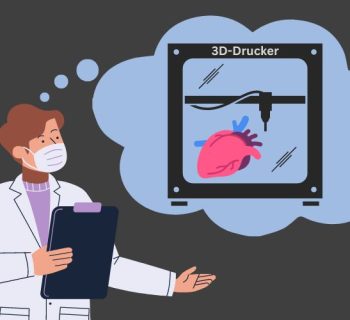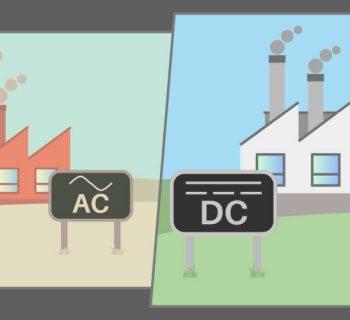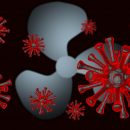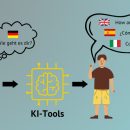Fossilien sind mehr als nur Versteinerungen oder Zeugnisse aus einer längst vergangenen Epoche. Seit 15 Jahren wird in der Forschung nicht nur der versteinerte Knochen betrachtet, sondern auch was in ihm steckt. Moderne Technologien wie das Rasterelektronenmikroskop geben einen Einblick bis in die Zellstruktur der Fossilien. // Von Björn Nehls und Dennis Roth
Die meisten Menschen kennen Fossilien nur als Ausstellungsstücke in Museen. An diesen Zeitzeugen werden in der Regel hunderte von Untersuchungen durchgeführt, um herauszufinden, wie das Fossil entstanden ist und unter welchen Bedingungen es sich gebildet hat. Diese Fossilisation ist ein komplexer Prozess über einen undefinierten geologischen Zeitraum. Besonders schwierig ist es, Details wie das Alter, die Farbe oder die ursprüngliche Hautbeschaffenheit mit dem bloßen Auge zu erkennen. Entsprechende technologische Mittel schaffen hierbei Abhilfe.
Ein moderner Blick in die Vergangenheit
Eine dieser Gerätschaften ist das Rasterelektronenmikroskop, mit dem ein tieferer Einblick in die Knochenproben möglich ist. Dort verbirgt sich nämlich der interessanteste Teil einiger Fossilen, organische Reste. Damit sich diese organischen Reste bilden, müssen die Fossilien während der Fossilisation einer schnellen Sauerstoffunterversorgung ausgesetzt sein. Das ist meist bei Fossilien in ehemaligen wasserhaltigen Gebieten wie Sümpfen, Seen und Mooren der Fall.
Mit neuen Mitteln zu neuem Wissen
Jahrelang waren viele Forscher überzeugt: Dinosaurier haben eine ledrige echsenartige Haut. Nach einem Fossilienfund galt dann, dass Dinosaurier gefiedert waren. Heutzutage ist man sich auch dabei nicht mehr sicher. Neue Erkenntnisse können durch neue Funde oder durch neue Untersuchungsmethoden und technische Hilfsmittel entstehen.
Professor Jens Lehmann, Paläontologe an der Universität Bremen, sagt dazu: "Wenn man beispielsweise durch rasterelektronenmikroskopische oder elementaranalytische Verfahren Körperteile fossiler Organismen umdeuten muss, weil man deren Natur vorher falsch gedeutet hat", könne durch moderne Technologien falsche Ergebnisse besser erkannt werden.
Antworten eingeschlossen im Stein
Früher gab es sehr wenige Mittel, um Fossilien genau zu analysieren. Selbst heute ist es möglich auf einer Ausgrabungsstätte tausende Vermutungen zu äußern, jedoch meist nur wenige klare Antworten auf seine Fragen zu finden. Deshalb ist besonders wichtig, das Fossil sauber vorzubereiten, bevor es in ein Labor geht. Mit verschiedenen Werkzeugen wie Steinsägen, Poliermaschinen und Peels für Anschliffe und Dünnschliffe werden laut Jens Lehmann Steinreste und andere nicht zum Fossil gehörende Teile entfernt.
- Dinosaurierbeinfossil //Foto: Dennis Roth
- Fossilnachbildung im Goldfuß-Museum Bonn //Foto: Dennis Roth
- Knochenstrukturen im Fossil //Foto: Dennis Roth
- Fossilnachbildung //Foto: Dennis Roth
- Meeresdinosaurierfossil //Foto: Dennis Roth
- Proben in Rasterlektronenmikroskop //Foto:Björn Nehls
- Professor Sander beim Untersuchen einer Probe //Foto: Björn Nehls
- Probe in Rasterelektronenmikroskop //Foto: Björn Nehls
- 3D printed Fossil // Foto: Dennis Roth
- Kristallisiertes Fischfossil //Foto: Dennis Roth
- Tintenfischfossil //Foto: Dennis Roth
- Fossil im Goldfuß-Museum Bonn //Foto: Dennis Roth
- Nachbildung eines Schädels eines Tyrannosaurus Rex //Foto: Dennis Roth
Aus dem Knochen in den Computer
Das Besondere ist, dass es mit heutigen Erkenntnissen und Gerätschaften wie dem Rasterelektronenmikroskop möglich ist die genaue Struktur von Knochengewebe zu untersuchen. Dieses Knochengewebe enthält Hinweise auf die Beschaffenheit der Knochen und welche Gefäße es innerhalb des Knochens gegeben hat. Somit können Wissenschaftler die Mikrostruktur von Lebensformen, die lange vor uns gelebt haben, erkennen, bewerten und neue Erkenntnisse daraus schöpfen.
Die Jagd nach einem Protein
Die Forschung über Fossilien und Fossilisation schreitet stetig weiter voran, insbesondere ist es mittlerweile möglich diese Funde auf molekularer Ebene zu untersuchen. Auch wenn die Forschung noch in den Kinderschuhen steckt, gibt es schon eine genaue Vorstellung, was in der Zukunft möglich ist. Hierbei wird insbesondere auf das Protein Kollagen geachtet. "Wir sind hierbei scharf auf die organischen Moleküle, da wir mit Ihnen Verwandtschaftsanalyse betreiben können und das geht dann alles so ziemlich in Richtung von Jurassic Park", sagt Professor Martin Sander, Paläontologe am Institut für Geowissenschaften in Bonn und Autor des Buches Fossilisation. Er ist überzeugt, dass Wissenschaftler in Zukunft weitere Methoden finden werden und die Forschung ausbauen. So tasten sie sich immer weiter an die DNA der Dinosaurier heran.
Teaserbild: Ein T-Rex Schädel //Foto: Dennis Roth
Die Auotoren
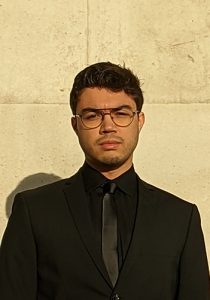
Dennis Roth

Björn Nehls